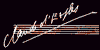|
|
|
 Im Schutz ihrer Berge, erstaunlicherweise, und trotz des Werks eines Gabriel Fauré, dessen kochende Lava sie unweigerlich darstellen, haben sich Die Lieder der Grafschaft Foix (Las cansos del Païs de Fouïch) jedem Versuch wahrer Klassifizierung oder genauer musikalischer Wiederherstellung entzogen, fern von dem Gesetz des Nordens, das aber Simon de Montfort von Pamiers aus erlassen hatte (1. Dezember 1212) und das seine Barone - im Namen des Staates und unterstützt vom Segen der Geistlichen - mit Feuer und Schwert zur Anwendung brachten; Lieder, viele Male als Kennworte überliefert von Generationen auf Generationen in einem Volk, das bekannt war für seine Würde und einen Sinn für Freiheit, der unüberhörbar ausgedrückt wurde in einigen brennenden Augenblicken der Geschichte, hatte doch Gasto Febus sehr schnell den im Albigenser Kreuzzug Besiegten die Hoffnung auf eine neue Unabhängigkeit wiedergegeben. Alte Lieder, bewegend in ihrem Geheimnis, denn sie besingen nicht den Boden, obwohl sie sich auf den Wegen des Midi verbreiteten, zum Klang von Laute oder Psalter oder in den Furchen des Pflugs, und Lieder von Verfassern, von neuerer Schreibung, die das Heimatland besingen und die vorausgefühlt haben, dass der Fortschritt nicht nur die Bären und Wölfe vernichten würde, sondern auch das Verschwinden einer Sprache (wenn nicht einer Botschaft), wissentlich totgeschwiegen oder getötet, nach sich ziehen könnte. Welche Glaubwürdigkeit hätte denn die Dissertation des Professors -Rektors Michel Chevalier, La vie humaine dans les Pyrénées ariégeoises , Paris 1956 (ein als fundamental dekretiertes Werk - durch den Historiker Emmanuel Le Roy Ladurie, Absolvent der Ecole Normale und Agregation, Doktor, Professor am Collège de France, Direktor der Bibliothèque Nationale de France und Kompilator des Werkchens: Montaillou, village occitan (Gallimard), der “bescheidene Historiker” Le Roy Ladurie total ungebildet auf dem Gebiet von Oc-Sprache und Literatur, wie er übrigens selbst zugibt, nicht ohne Bravour, in seinem an uns adressierten Brief vom 24. Dezember 1982; die Chevalier Dissertation, veröffentlicht mit Hilfe des Erziehungsministeriums, in der der Autor uns wissen lässt - unter anderen Prahlereien - , dass die berühmte Devise der Grafschaft Foix: “Tocos-i se gausos!” (Rühre daran, wenn du es wagst!) als “Rühre daran, wenn es dir gefällt!” zu übersetzen sei, wo doch jeder Einheimische weiss, dass es sich um die stolze Antwort einer kleinen Hirtin handelt, die vom Grafen von Foix in irgendeiner Ecke auf der Weide in die Enge getrieben ist; Dissertation, die selbstverständlich das einstimmige und sehr ehrenvolle Lob von sorbonnischen Prüfungskommissionen bekommt, die mit einiger Sicherheit in fortgeschrittenem Zustand lexikographischen Winterschlafs sind. (“Möge das Gaskonische es ausdrücken, wenn das Französische es nicht vermag”, protestierte schon Michel de Montaigne !). Oder auch, was schliessen aus der Zählung dieser “dreissig Tage, die vom 13. April zum 13. Juni des Jahres 1210 gehen”, so wie addiert von diesem Professor aus Wallonien, sogenannter Fachmann für den Albigenser Kreuzzug und an die Sorbonne versetzt, um dort angeblich unsere mütterliche Sprache zu lehren; mathematische Operation, die dem Komputer von Prof. Stephen Hawking (Gonville & Caius, Cambridge) die Stimme verschlägt, mangels irgendwelcher Prüfungskommissionen für Grundschulabschluss in früheren Zeiten.
Da die lateinischen Akten des Inquisitors Jacques Fournier (geboren 1285 in Canté, bei Saverdun, Grafschaft Foix, und 1334 unter dem Namen Benedikt XII. Papst in Avignon geworden) merkwürdig stumm bleiben in Bezug auf die Stellung der offiziellen Kirche gegenüber weltlichen Liedern in der Volkssprache (oh Duvernoy !), die bis in unsere Zeit überkommen sind, so wie sie von Troubadouren, Jongleuren oder anderen Schreibenden (Escrivans?) - unter ihnen der Anonyme, Autor aus Foix des 2. Teils des Liedes vom Albigenser Kreuzzug - verbreitet wurden, wird man indessen wagen, anzudeuten, dass sich hinter den Worten und den Tönen der meisten dieser Texte in der Vulgärsprache (oh Marrou-Davenson!), die beim ersten Anhören Unbedeutendsten (La Jano; Lé chot; Aval, aval i’ a uno pradèto) oder die Bekanntesten (La Canso dels dalhaires, Lé Bouiè) oder die Grandiosesten (Aqueros Mountanhos), in Wirklichkeit stillschweigende Einverständnisse und Geheimnisse verbergen, deren Echo nur in der Seele der Kuhhirten oder in der der Schnitter widerhallt, denn allein Worte und Töne konnten sich der unversöhnlichen Entfaltung animalischer Grausamkeit der Männer der geistigen Gerechtigkeit entgegenstellen (“wie man in meinem Land sagt, wo der Segen nicht hilft, setzt sich der Stock durch”, so sprach in Prouille am 15. August 1217 Dominikus, spanischer Doktor, geboren im alten Kastilien, Erfinder des Rosenkranzes, Variante des Suren-Abakus der muselmanischen Brüder, Prediger und Gründer des Ordens der Prediger-Brüder, 1234 heiliggesprochen) und gleichzeitig ermöglichen, das Wesentliche des verzweifelten Widerstands der Reinen gegen die Haudegen noch im Halbdunkel befindlicher Zivilisationen weiterzugeben: einfache Worte oder kindliche Töne; Schlüssel, um zu einer universellen Denkweise zu gelangen, dazu bestimmt, eine gesellschaftliche Ordnung ohne übertriebene Härten aufzubauen, im Widerspruch zu den Ausschweifungen oder kaiserlichen Launen des ewigen Moments. Diese Verurteilten der Inquisition, der Folter und dem Tod ausgeliefert von Interrogatoren, die mitgeführt wurden in den impedimenta (Gepäck) der Kreuzritter, aus dem Norden, gekommen unter den Standarten einer unerbittlichen transalpinen, wenn nicht transpyrenäischen (oh Simon, oh Dominikus, oh Aquinas !) Orthodoxie, die sich aus sich selbst ernährt mittels magischer Litaneien, unbegrenzt psalmodiert von einer närrischen Menge von Tafel-Ausgräbern, Papyrus-Entrollern, Urkunden-Plünderern, bequem in ihre Lehr-Stühle eingepasste Doktoren, die mit gequältem Hüsteln (oh Jobelin Bridé !) ihre gregorianisierte Geschichte vor nach Seligsprechung dürstenden Bewunderern ausstossen, einige von den Heiligen Dominikanischen Stätten zum Berg Ste Geneviève (vergessen wir nicht die Sitzungen über religiöse Geschichte am Sitz des Dominikanischen Zentrums von Fanjeaux, Sitzungen unter der Amtsgewalt des Präsidenten von Paris-IV Sorbonne !); einige von den Hügeln Palästinas zu den Plattheiten von Flandern (ignorieren wir nicht die Hebräische Universität von Jerusalem und seine okzitanische Antenne zu Nr. 16 rue de la Sorbonne !); einige von den Tälern Tübingens zum Schnee des Fujiyama (lassen wir nicht diese Sturmabteilungen aus, linguistisch geschult in der gaskonischen Sprache von Herrn General Ernst Gamillscheg, bevor sie über der Haute-Ariège abgesetzt und schnell gefasst wurden wegen unzureichender örtlicher Aussprache, dann neu gruppiert vor dem Bahnhof von Saverdun, Nähe Canté, Land Foix !),Anbeter, die sich selbst schliesslich inthronisiert sehen in Rabelais’ staatlich anerkannten “Sorbonneseleien” der rue des Ecoles, in Sossen-Kollegs, Spezialität Béarnaise, oder in Nationalen Zentren für Ungefähre Forschung (die fin’ amors, kesako?) ; all dies sich bewegende Magma unermüdlich umgerührt von schwindelerregenden Bahnhofsschriftstellern à l’occitane, oder kostspielig “geliftet” von diplomatischen Kosmetikerinnen, denen Produkte zur Schönheitspflege fehlen, die darauf versessen sind, dem faltigen Gesicht des “Katharismus” ein wahrhaft gnafroneskes Aussehen zu geben, um es desto besser für Marionetten-Theater zu benutzen, zwischen Pappmaché-Mauern von Festungen, denen es an Hügelchen fehlt, oder um es dem Trommelfell darzubieten in einem Tamtam, das ausgelöst ist von dem tremulierenden Taktstock des Anführers einer Moulin-Null Revue, dekorierter Vorkämpfer der erniedrigten Note, ohne andere reelle Bedeutung als die, die Gänse des “Grrrrrand Théâtre” (Gabriel Fauré dixit) zu mästen oder die Enten der halle aux grains (Kornmarkt), und dies zum grössten Profit der “Heuler der Kirche” (so rief der Toulousaner Pierre Garsias die Franziskaner an, die von der Folterbank), wenn nicht von anderen ungelenken Handhabern von Achtelnoten, Behelfskomponisten, die ihre Tonstatuetten zu Füssen eines Idols von Stein legen.
Alle diese Legionen von Gewissen-Berichtigern selbstverständlich vollkommen unfähig, die Sprache, über die sie abhandeln, zu verstehen, zu sprechen oder zu singen, samt und sonders Wiederholer der “losange” (verleumderische Denunziation), die sorgfältig verborgen ist im Manuskript 4030 der vatikanischen Bibliothek und als solche nachsichtig vervielfältigt wird in den Werkstätten von Robert de Sorbon, Kaplan und Beichtvater von Louis IX, in einer Unzahl von Thesen, Antithesen, heiligen Thesen, in Erwartung des “Nihil obstat”, zum grössten Ruhm des ganzen Plunders, oder einfacher, der hl. Anne (oh Dr Rouquet !), und die nach sieben Jahrhunderten von fol’ erranza (sei sie nach Art von Quanten) oder, wenn man das Patois der Somme vorzieht, von douchereux errements (seien sie nach Art des Canticum), noch dabei sind, die Vorzüge einer Form zu preisen, die, auf gut Wallonisch, “nichts” wert wäre; was also voll, eschatologisch, wenn nicht schatologisch, das natürliche Ende des anonymen Autors der Vie de Ste Catherine in pikardischem Patois rechtfertigen würde, um desto besser, d.h. sicher und ein für allemal, das Gebiet des Besatzers zu markieren: *** Diese Initialbotschaft, initiatorisch für manche, die letzten Patois -Sprechenden weit weg auf dem Lande, diejenigen, die nicht gekrönt sind mit dem Lorbeer eines Diploms für Basis-Studien, gebührend gestempelt von den Akademien des Nordens oder von dem Herzog von Lévis-Mirepoix (Académie Française), der uns einige Wochen vor seinem Tode versprochen hatte, die langue d’oc zu lernen, die Sprache der Pächter seiner Ländereien, die vor Zeiten konfisziert wurden zum Nutzen der schlecht artikulierenden Sprecher des Fränkischen, eben diejenigen, die, nach François Mauriac (Académie Française) den Griff der Pfanne hielten, in der sie das Landesprodukt brieten, d.h. diese heretischen Aufrechterhalter eines Idioms, das man mit dem Namen patois brandmarkt; Idiom, das von den gaskonischen Pachtbauern des Weinanbauers Monsieur Mauriac (alias “ciboire”, ein ihm von Louis-Ferdinand Céline verliehenes Etikett) gesprochen wird; in Wahrheit eine Sprache, die von mehr als 500 Troubadouren veranschaulicht wird, absolute Quelle der europäischen Lyrik (oh Bédier, oh Frappier, oh Legentil und tutti quanti !), eine von ganz Südeuropa jahrhundertelang ausgeübte Sprache, und, noch heutzutage, in all ihrer dialektalen romanischen Mannigfaltigkeit: Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Catalanisch, Rumänisch, etc., Sprache, die auf die bekannte Weise das Denken einiger Nürnberger Ideologen zeichnete (hatten nicht die Letzteren 1944 geplant - mit Hilfe der Wehrmacht - innerhalb der Mauern selbst von Schloss Montségur (Land Foix, 1207m) ein Aussergewöhnliches Konzerts zu geben, Konzert, das schliesslich 1984 stattfand (kolossales Jubiläum, wenn es je eins gab !), unter nicht weniger aussergewöhnlichen Bedingungen (vgl. Dépêche du Midi, 16. 7. 1984).
Diese Initialbotschaft also, wir haben versucht, sie zu hören, vielleicht sie hören zu lassen in dieser Wiederherstellung der Lieder, für die ein vokaler Widerstand charakteristisch ist, immer gültig in Bezug auf Ereignis, selbst wenn, in den Worten vonGabriel Fauré, Schüler von Saint-Saëns, der Schüler von Gounod war): “Volkslieder genügen nicht, eine nationale Kunst der Musik zu schaffen. Sie müssen die Basis formen, eine Art Substratum. Es ist nötig, dass Musiker, wahre Musiker, die ihr Handwerk von Grund auf kennen und eine schöpferische Gabe haben, sich davon inspirieren lassen.” Gabriel Fauré, der, um ihm gerecht zu werden, immer dem Lager der Häresie treugeblieben ist (im Juni 1911 präsidierte er über das Komitee zur Errichtung des Monuments für Esclarmonde), Gabriel Fauré, der übrigens niemals die jährlichen Versammlungen der in Paris lebenden Ariégeois verpasste, wo man “patois” sprach (der Komponist aus der Ariège beherrschte vollkommen die Sprache seiner Vorfahren) und wo man einstimmig das Arièjo, moun Païs, von Sabas Maury, Priester in Varilhes, sang, aber auch den nicht weniger berühmten Vierzeiler von Montségur, der weiterhin von lebendiger Aktualität ist: *** N’Esclarmonda (Esclarmonde, im Dialekt der Ile de France), ihr Name wird zum ersten Mal in dem Gedicht des Troubadours Guilhem Montanhagol, Non an tan dig li primier trobador (Sie haben nicht alles gesagt, die ersten Troubadoure), zitiert, Verse, deren Übersetzungen oder Interpretationen, vorgelegt, urbi et orbi, von der Grossen Philologie, amüsieren, da in der Folge der Arbeiten des “gelehrten” Professors P. T. Ricketts (Les Poésies de Guilhem de Montanhagol , “Pontifical” Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Canada, 1964) das Institut de Langue et Littérature d’Oc der geisteswissenschaftlichen Fakultät von Paris Sie 1978 in den Vordergrund romanisch-philologischer Aktualität rufen sollte, indem es das Studium dieser “Tornada” dem Scharfsinn seiner Escholiers unterbreitete, wenn nicht dem der Nomenclatura des Worts, der aus Adams Orgasmus hervorgegangenen, von der eine nicht erschöpfende namentliche Liste (Doktoren ès fol’ amor und Gaukler Unserer Lieben Frau fröhlich gemischt in endlosem Défilé hinter einem Pompon girl des philologischen Kreuzzugs) eingesehen werden kann am Ende des Buchs Tristan und Isolde (INFO Verlag, Karlsruhe, 1989), ein Werk, das Professor Jean Boutière gewidmet ist, Direktor und Gründer des Institut d’Etudes provençales et roumaines der geisteswissenschaftlichen Fakultät von Paris, Präsident und Gründer der Congrès internationaux de Langue et Littérature d’Oc, Direktor der Reihe Les Classiques d’Oc, Ed. Nizet, Direktor Jean Boutière, dessen Namen, “das ist klar”, man vergeblich zwischen den Mauern oder in den Bibliographien des besagten Instituts sucht! *** N’Esclarmonda, wir nannten diesen Namen auch anlässlich unseres Beitrags: La Canso de Gasto Febus à Frédéric Mistral (Congrès FILLM, Aix-en-Provence, 1978, siehe Sitzungsberichte), eine Erinnerung, die uns wesentlich schien für die Aufhellung des gestellten Problems, nämlich: “Koïnè lyrique” ou “Voix d’un Peuple”?, eine Antwort, wenn es eine gibt, auf die buccinante Erklärung des Herzogs von Lévis-Mirepoix von der Académie Française: “Gewisse Länder haben, was ich einen musikalischen Schlüssel nennen werde” (in Historia, November 1976: Les Cathares contre la France), Vorahnung oder letzte Beichte dieses Marschalls des Glaubens (in Erwartung des Consolamentum?), so wie er sie uns hat mitteilen wollenin seinem letzten Brief aus Léran (4. April 1981); dieser gleiche Beitrag, im Verlaufe dessen wir zu zeigen versucht hatten, wie bei der in den Schlösser-Sälen überhand nehmenden Monotonie mancher Troubadour Bestrafungdafür trotzte, dass er gewagt hatte, in den spontan-naiven Bourrées oder Réménilles, die das Erwachen des Frühlings in den Wäldern und in den Herzen feiern, einen Lichtschein des Lebens zu erahnen oder Lichtschein totaler Liebe; Synonyme einer Wahrheit, unsagbares Wesentliche, die nur triumphieren kann in geteilter Gewissheit, in dem Sinn, dass sie einzig ist und unendlich vielfach, hervorgegangen aus Feststellung undnicht aus Überzeugung; so sehr gesucht, so selten erahnt; die verlangt, dass man alles vergisst, um sich besser zu erinnern; mit einem Wort: die allein heller strahlt als die ersten krematorischen Scheiterhaufen des zivilisierten monotheistischen Europas, d.h., und in unserer Sprache: N’Esclarmonda. *** Der 108. Congrès des Sociétés Savantes (Grenoble, April 1983) sollte uns erlauben, die Iles d’Or (Lis Isclo d’Or) des provenzalischen Gebiets zu erreichen, des Gebiets von Frédéric Mistral, der, nicht mehr als die Félibres, “Esclarmonde, Stern von Montségur”, homerisches Epithet, das er auf sie anzuwenden beliebte, nicht vergessen hatte. Die Lieder der Félibres “Lou soulèu me fai canta” (die Sonne macht mich singen) wiederholte Frédéric Mistral gern gegenüber dem Maler und Musiker Bonaventure Laurens, der soeben sein Portrait vollendet hatte - er hatte auch das von Gounod gezeichnet - und bestand auf der Bedeutung von Licht und Musik als Ausgangspunkte seiner lyrischen Inspiration; der Maler bedauerte seinerseits, dass es kein Klavier in Maillane gab, Instrument, auf dem er Roumanille, Aubanel, Seguin und andere hätte begleiten können, natürlich nicht zu vergessen Charloun Rieu und Frédéric Mistral, wenn sie mit Schwung das Lied von Magali oder andere Perlen des Oc Landes anstimmten. Denn Mistral engagierte sich persönlich mit seiner “warmen und musikalischen” Stimme, später “manchmal entfernt, geheimnisvoll und verschleiert”, sei es, um La Coupo zu singen, gleich einem “die Messe zelebrierenden Hohenpriester, dem die Menge der Gläubigen im Chor antwortet”, sei es, um den Refrain des losen Liedes, das Félix Gras Papst Clemens V. gewidmet hatte, zu wiederholen, oder sei es auch, um im einzelnen die schlüpfrigen Verse wiederzugeben, mit denen die Bewohner von Maillane die von Saint-Rémy aufs Korn nahmen:
La farandoulo de Trenco-Taio Beim provenzalischen Essen, berichtet Denis Poullinet, einer seiner engen Freunde, erzählte Frédéric tausend wunderbare Geschichten, aber er liebte es, seine bevorzugten Lieder singen zu lassen: Les Célibataires, geschaffen für Ranquets Hochzeit, oder die Chanson des Conscrits, kleine Werke des Übermuts, die in keiner Weise einen Schatten auf die Klagen oder Hymnen warfen, an die er sich mit Inbrunst erinnerte, hatte sie doch Madame Mistral - Mutter von Pilgerfahrten nach Sant Gènt, denSaintes Maries oder einfacher, Graveson, mitgebracht.
In einem nicht weniger bewegenden Register entschied sich Mistral, patriotischer Dichter der Occitania, für diese atavistische Lyrik, für diese Besonderheiten des Volks des Grossen Südens, dessen Chanson de la Croisade albigeoise, sagte er, die “Bibel unserer Nationalität” darstellte, so wie er in den spontanen Liedern “losgelöste Blätter” des Neuen Testaments dieser Bibel sah, Blätter, deren Zahl er nicht zögerte zu vermehren, wobei ihm seine Freunde vom Félibrige halfen, da er seinen Liedern eine praktische Rolle in seinen Lehren und seinem Kampf anwies. Endlich kam Mirèio ... “Aber, Meister, das wird sie niemals singen können!”, rief Saint-Saëns aus, erschreckt von den von einer Miolan-Carvalho verlangten stimmlichen Mitteln, die für eine exakte Wiedergabe der Air de La Crau in der ersten Version von Mireille nötig sind; worauf Gounod zurückgab: “sie wird es singen müssen,” wobei er seine schrecklichen Augen weit aufriss ... Es ist bekannt, dass der Kritiker Scudo dem Komponisten von Faust eine “nutzlose” Reise in die Provence vorgeworfen hat. Am 23. März 1863 hatte sich Gounod diskret unter dem Namen Monsieur Pépin im Hotel Ville Verte von Saint-Rémy installiert, wobei ihm der Organist, Monsieur Iltis, Direktor des Orphéon, behilflich war, da ihn Mistral, den er um Erlaubnis gebeten hatte, Mireille zu vertonen, ermuntert hatte: “Sie sind in die Welt gekommen, um die Provence zu entdecken...Sie haben sie, Ihre Oper!” Gounod machte also die “nutzlose” Reise in die Provence, während die Partitur von Mireille die Debatte neu eröffnete, über eine Musik, deren melodische Freimütigkeit und harmonische Eleganz - gleichsam sonntäglicher Schmuck des naiven kleinen Bauernmädchens vom Mas du Juge - , weit weg von dem lyrischen Pomp der Soubretten und Marquisen des 18. Jahrhunderts oder der ihnen folgenden romantischen Heldinnen, entschieden nicht in French Cancans nach Art von Offenbach einmünden konnte. *** Gounod begab sich oft nach Maillane, las Mistral das Libretto vor, das Michel Carré aus Mirèio gezogen hatte (“es bewegt ihn, er weint ...”), fuhr bis nach Nîmes, um ein Klavier bei dem Hersteller Dumas zu bestellen, liess es hochziehen bis in sein Zimmer im 2. Stock von Ville Verte, kaufte einen faltbaren Hocker, Notenpapier, verbrachte viele Stunden im Tal von Sant-Clergue (“ich war buchstäblich freudetrunken; dier Motive kamen mir in den Sinn wie Schwärme von Schmetterlingen; ich brauchte nur die Arme auszustrecken, um sie einzufangen”), erging sich auf den Wegen des mas du Peyrou, des mas de Gros, des mas du Juge, des mas Chastuel, erkletterte die steilen Hänge von Les Baux, erreichte endlich die Saintes-Maries, um noch besser die Heldin aufzufinden, die soeben zu Fuss “die weite Ebene und die Feuerwüste” dieser Crau durchquert hatte, die beim ersten Anhören Camille Saint-Saëns so sehr alarmiert hatte, wenn nicht jenen Dirigenten neueren Datums, der die Steine dieser Crau in der klimatisierten Luft eines Mercedes nicht wahrnahm (oh Mirella!). ***
Professor Saint-Gor also, der am Mikrophon der geisteswissenschaftlichen Fakultät von Aix anlässlich der 100-Jahr-Feier von Mireille 1959 stolz erklärt hatte: “Literatur ist nicht meine starke Seite und nicht mein Gebiet” (Montfort soit qui mal y pense !), bevor er drei von der Betrachtung der Crau-Wüste vertrocknete Vierzeiler, plus sechs Vierzeiler in Alexandrinern veröffentlichte, um die Montagne Sainte-Victoire zu krönen, wahrscheinlicher “Federbusch” einer wissenschaftlich-literarischen Karriere, die von seinen Biographen in Liège auf 1270 Seiten Mélanges so blankpoliert wurde, dass letztere das bekannte Aroma der Sévigné in den Schatten stellen: “man schickt uns Nachricht, dass die Minimen unserer Provence dem König eine Abhandlung gewidmet haben, wo sie ihn mit Gott vergleichen, aber wo man klar sieht, dass Gott nur die Kopie ist”, Professor Saint-Gor also, auch bekannt unter der Benennung “Marc-Antoni l’oouriginaou”, gemäss der Definition des Lexikographen J. T. Avril (Dictionnaire Provençal-Français, Apt, 1839), seit er entdeckt hatte, dass der berühmte Autor des Lebens von Marius der nicht weniger berühmte Liebhaber von Madame de Sade war, allerletzte Enthüllung, deren aufschneiderische Geschichtlichkeit in France Latine (Nr. 75/76), der sehr offiziellen Zeitschrift von 16 rue de la Sorbonne, gekostet werden kann, und dies bevor er mit einer prosaisch trockenen Feder behauptete, dass es seines Wissens “ keine Aufführung einer Mirèio auf Provenzalisch 1914 in Marseille gegeben hat. Alle Werke, die ich konsultiert habe und die Erinnerungen der Félibres, die Mistral gekannt haben, etc.”, so also hat sich der Direktor Saint-Gor, Augustus Caesar, kategorisch ausgedrückt, wenn nicht ultra-kategorisch, in seinen wissenschaftlichen Verneinungen (Brief vom 13. Februar 1978), diese letzteren übrigens kräftig bestärkt von der Dissertationsschreiberin im Amt (Brief vom 16. Februar 1978), selbst katechetische Produzentin eines Katalogs von 660 Seiten Logorrhoea in jonglaro-troubadoureskem Stil (1170 gr auf der Waage der Metzgerei Notre-Dame), mühsame Aneinanderreihung von Versen ohne Musik, wahrscheinlich um desto besser das mittelalterliche Distichon: Indessen nicht weniger kategorisch die Presse von Marseille, in diesem Fall der Petit Marseillais vom 11. Juni 1914 mit den Schlagzeilen: “Heute abend um 8Uhr15 werden wir einer grossartigen künstlerischen Darbietung im Freilichttheater Athéna-Niké beiwohnen. Um Gounod in die Lage zu versetzen, die unsterblichen Seiten von Mireille zu komponieren, hat Michel Carré nach dem provenzalischen Gedicht von Frédéric Mistral sein Opern-Libretto geschrieben. Dieses Libretto von Michel Carré haben jetzt Pascal Cros und Jean Monné sehr erfolgreich ins Provenzalische übersetzt. Die Interpretation von Gounods Meisterwerk ist Elite-Künstlern anvertraut worden, alles Provenzalen. Es sind dies der ausgezeichnete Tenor Martel, der für uns vom Théâtre de la Monnaie zurückkommt; der eminente Künstler Marcel Boudouresque, der erst vor einigen Tagen wieder an der Opéra-Comique triumphierte; die herrliche Maryse Récam, auch sie von der Opéra-Comique, deren Organ sich auf erstaunliche Weise entwickelt hat; der wunderbare Bariton M. Janaur, der zahlreiche Triumphe während seiner Zeit an der Opéra Khédivial in Kairo feierte; die charmante Dugazon der städtischen Oper von Marseille, Mademoiselle Michaël; schliesslich die Damen Lise Pierson und Marcelle Nicolas und die Herren Berton und Rivet. 75 Choristen der Concerts Classiques und des Athéna-Niké bilden mit dem Orchester der städtischen Oper einen imposanten Rahmen, der gekonnt dirigiert werden wird von Herrn F. Rey ...” Und die Zeitung fügt hinzu: “ Die Leser des Petit Marseillais werden guttun, sich ihre Plätze und Sonderfahrkarten für die Strassenbahn im Vorverkauf der städtischen Oper, rue Molière (Tel. 3. 58) zu sichern.” Seine Eintrittskarte kaufen, ja; aber in welcher Sprache am Telefon reservieren angesichts der Werbung vom 9. Juli in Form eines Dialogs : Provenzalisch für den Käufer aus Ventabren, Französisch für die Kartenverkäuferin, die schliesslich sagt: “Verflixt! Mein Herr, wenn man eine fremde Sprache spricht, lässt man sich am Telefon von einem Dolmetscher begleiten ... Auf Wiedersehen!”; und der Käufer folgert: “Aquelo empego! Parei que sian d’ estrangié à Ventabren!” (Was für ein Pech! Es scheint, wir sind Ausländer in Ventabren!) Und das war 1914! stellt Paul Nougier fest, Direktor des Rampau d’oulivié, der uns diese schöne Geschichte berichtet (Brief vom 17. Oktober 1978). Am 13. Juli 1914 triumphierte derselbe Petit Marseillais: “Mirèio, die Oper von Gounod, wird zum ersten Mal mit sehr schönem Erfolg in provenzalischer Sprache gesungen. Es war gut, sogar sehr gut. Manche hatten diese Initiative skeptisch aufgenommen: die Aufführung auf Provenzalisch einer lyrischen Oper, die im wesentlichen provenzalischen Ursprungs ist. Nun zeigt es sich, dass das Ereignis ihre Befürchtungen zerstreut hat. Mirèio, interpretiert von unseren eigenen Sängern, die sich in unserem harmonischen Idiom ausdrücken, hat bei dem äusserst zahlreichen Publikum, das Samstagabend das weite Rund des Athéna-Niké füllte, einen lebhaften Erfolg davongetragen. Die Übersetzung des französischen Librettos, den gut provenzalischen Dichtern Pascal Cros und Jean Monné anvertraut, der erstere unser Freund und Mitarbeiter an dieser Zeitung, hat die Verwirklichung eines Originalwerks ermöglicht. Und die Sprache der Provence, die bekanntermassen auf wunderbare Weise musikalisch ist, hat ihren Zauber der Musik Gounods hinzugefügt.” Und der Petit Marseillais beschliesst, halb Feige (von der Sorgue?), halb Traube (aus der Crau?) : “Die Aufgabe, Sänger zu versammeln, die den provenzalischen Akzent haben, war zugegebenermassen ziemlich schwierig; die Interpreten sprachen eigentlich nicht alle perfekt die Sprache der bäuerlichen Bevölkerung der Crau oder der Camargue. Den einen hielt man ihren Eifer zugute, der meist zum Erfolg führte; den anderen die natürliche Leichtigkeit in der Handhabung einer Sprache, die nicht gerade die von lyrischen Opern ist. Mirèio auf Provenzalisch, von Erfolg gekrönt auf einer Freilichtbühne von so hohem Ansehen, brauchte sich nur noch auf den Weg nach Arles zu begeben: das hat sie gestern gemacht. Und es war ein Siegesweg.” Nicht weniger kategorisch schliesslich die Presse von Arles vom 14. Juli 1914, am Tag nach der Mirèio - Aufführung, wo man lesen konnte: “das Orchester stimmte seine Instrumente für die Aufführung von Mirèio, die Mireille von Gounod, deren Libretto für diese Gelegenheit auf Provenzalisch übersetzt worden ist. Hat die Übersetzung von Herrn Pascal Cros, Félibre in Marseille, es geschafft, diesem Werk ohne provenzalischen Charakter wenigstens einen provenzalischen Anschein zu geben? Ich fürchte, nein und dass man nur die fromme Absicht des Übersetzers loben muss...Als die Rede von einer Übersetzung von Mireille war, erklärte Madame Mistral sehr bestimmt, dass sie für ihre Person nur eine Aufführung in reiner rhodanischer Sprache erlauben würde. Man akzeptierte eine Verpflichtung in diesem Sinn und übertrug Jean Monné, Majoral des Félibrige, die Aufgabe, über der Einhaltung zu wachen. Was ist geschehen? Ich weiss es nicht, aber beim Anhören des Werks haben wir festgestellt, dass der Text von Herrn Cros von Marseiller Wörtern, das patois von Marseille, wie ehemals gesprochen (la Sartan), wimmelte. Das Haus war nicht das oustau, sondern das meisun, was nie provenzalisch war und nur ein Beispiel von tausend ist...” Und Jean de Comtat bedauert: “Wo man doch, wenigstens für den Dialog, mit vollen Händen aus dem Text des Gedichts von Mistral hätte schöpfen können! Glücklicherweise zerstreute und überspielte die Brise zum Grossteil die gesprochenen Teile des Stücks, und die Melodien von Gounod haben ohne allzu grosse Schwierigkeiten den Rest durchgehen lassen”; während Falco de Baroncelli händeweise Verse in die riesige Menge warf und rachsüchtig schrie: “Vengue li jouino chato!” (Hierher die jungen Mädchen!) Feierten sie nicht in Arles die Festo Vierginenco? All dieses Muffige veranlasste “Parlo Soulet” (der Félibre Louis Gros aus Avignon) ein paar Jahre später (Le Provençal, 1. Februar 1950: Zum Thema der provenzalischen Version von Jean Monné), festzustellen, dass es von dem Libretto von Michel Carré zwei Bearbeitungen auf Provenzalisch gibt, die tadellos zu der Musik von Gounod gesungen werden können. Die erste ist von Raoul de Candolle, die zweite von Jean Monné, der Félibre Majoral war... Parlo Soulet, der in demselben Artikel wünschte, dass die Inszenierung einer Mirèio auf Provenzalisch Marceau Pierboni anvertraut würde, nach Familie und Geist aus Saint-Rémy stammend und ein “Regisseur, von dem wir wissen, dass er dieses Werk liebt, es versteht und es auf die Bühne bringen kann unter dem Einsatz seiner eigenen Mistral-Seele ...” Marceau Pierboni (Brief vom 26. Oktober 1979) nuanciert dementsprechend: “Meines Wissens existiert keine Spur von der provenzalischen Version von Jean Monné. Léon Bancal, ehemaliger Direktor (verstorben) der Tageszeitung Le Provençal, Enkel von Jean Monné und interviewt zu dieser Frage durch einen meiner daran interessierten Freunde, hatte mit Bedauern erklärt, dass er trotz geduldiger Suche dieses Manuskript nicht unter den zahlreichen Papieren seines Grossvaters hatte entdecken können, zu seiner Überraschung, denn es besteht kein Zweifel, dass es mehrere Exemplare gegeben hatte, die damals notwendig benutzt wurden, um das Werk einzustudieren ... Vielleicht wissen Sie, dass vor der Version von Jean Monné (der Anteil von Pascal Cros an dieser Arbeit existiert praktisch nicht) zwei andere Versionen, von denen man wenig gesprochen hat, erschienen waren. Die erste war das Werk eines Gelehrten von Saint-Rémy, Adolphe Michel, der mit Gounod während dessen Aufenthalt in Saint-Rémy zusammen war; dieser Dichter, 1904 gestorben, hatte seine Arbeit nach der Originalfassung von Mireille, die er ganz übertragen hatte, angefertigt. Die zweite Version ist von dem Félibre Ravous de Candolo, 1915 in Aix gestorben. Von diesen beiden gibt es so wenig eine Spur wie von der Version, die uns beschäftigt (Anmerkung der Redaktion: Herr Marcel Bonnet, Félibre Majoral, hatte uns indessen versichert, im Besitz des Manuskripts der Libretto-Übersetzung von Mireille auf Provenzalisch durch Adolphe Michel zu sein, Manuskript, das ihm von der Enkelin von Adolphe Michel übergeben worden war.). Vielleicht könnte man versuchen, eine Erklärung für diesen Mangel zu finden. Es ist einerseits merkwürdig, dass die Witwe von Frédéric Mistral, bekannt für ihre strenge Unnachgiebigkeit, nicht nur die Bearbeitung, sondern auch die Aufführung einer anderen als der vom Meister akzeptierten Mireille zugelassen hat. Andererseits wäre es überraschend, wenn Michel Carré, Libretto-Autor, und vor allem der Verleger Paul Choudens nicht ihr Wort dazu gesagt hätten. Es ist möglich, dass die eine wie auch die anderen fühlten, dass die (vielleicht Versuchs-) Aufführung in Marseille und die, sagen wir, rituelle von Arles nicht wiederholt werden würden...” *** Am 19. März 1864 - Camille Saint-Saëns hatte es vorhergesagt - erstickte Madame Miolan-Carvalho, trotz der Gegenwart von Frédéric Mistral, hoffnungslos an der Arie der Crau (sie war aber doch in Marseille geboren !), obwohl sie im Voraus dem Komponisten vorsichtshalber gestempeltes Papier geschickt hatte, um ihn zu veranlassen, dieses “Geschrei” zurückzuziehen. Sie hatte auch eine Walzer-Arietta verlangt, “schnelle kleine Schwalben”, die allein donnernden Applaus bei der Uraufführung erhielt, was einen enttäuschten Charles Gounod veranlasste, dem stolzgeschwellten Direktor Carvalho (in der Ile de France geboren (Mauritius) “Sie haben immer recht !” zu sagen. Die Presse von 1864 sprach indessen von einem “faden Werk”, von “verdünnter und entfärbter” Musik, von “Sur le Pont d’Avignon, on y crève, on y crève...”. Ist es verwunderlich, dass Mistral, der das Werk genehmigt hatte (man erinnere sich, dass ihm in Maillane die Tränen gekommen waren, als Gounod ihm das Libretto von Michel Carré vorgelesen hatte), sich seinerseits beklagt: “man hat mich verdorben, geschunden, entstellt, etc.”, wobei er allerdings zugibt, dass es ihm “eine hübsche Summe an Urheberrechten” eingebracht hatte. Was die Félibres anbetrifft (Aufrechterhalter der provenzalischen Sprache, die von Lamartine bewundert worden war und die Mistral 1904 den Nobel-Preis für Literatur einbrachte), sie schmollten: “Empachan pas d’amira la Mireille de Gounod, chacun soun goust.”(Wir verhindern nicht, dass die Mireille von Gounod bewundert wird; jedem sein Geschmack!), während Bonaventure Laurens schon seinerseits Mistral angekündigt hatte: “Wir Provenzalen, wir wollen sogar, dass die Personen (der Oper) die Sprache Ihres Gedichts sprechen und nicht französisch.” Und jeder konnte sich für eine Seite entscheiden, von den Avenuen von Aix-en-Provence bis zur hintersten Ecke Europas, hart an die Grenzen dieses Empèri dou Soulèu (Sonnenreich), der grosse Traum des Dichters von Maillane, nämlich Rumänien, da doch Vasile Alessandri, dem rumänischen Dichter, der grosse Preis der Jeux Floraux du Félibrige verliehen worden war (Montpellier, 25. Mai 1878), während 21 rumänische Abgeordnete ein Telegramm unterzeichneten, in dem sie ihre “lateinischen Brüder” nach Bukarest einluden. Hatte nicht Ronsard selbst 1580 bei den Jeux Floraux von Toulouse die Silber-Statuette für ein Stück erhalten, in dem er seinen Vorfahren Banul Mârâcinâ besang, der von den Ufern der Donau herbeigeeilt war, um “Frankreich, der Mutter der Künste, der Waffen und der Gesetze”, Hilfe zu leisten, womit er eine historische Kontinuität einleitete (Nerto, von Mistral, ist Ihrer Majestät, der Königin Elisabeth von Rumänien, maîtresse ès Jeux Floraux, gewidmet), die von der Universität nicht missbilligt wurde (Professor Boutière war, wie wir gesehen haben, Direktor des Institut d’Etudes provençales et roumaines der Sorbonne) und auch nicht von der lyrischen Kunst, da Mirèio auf der Bühne der Rumänischen Staatsoper geweiht werden sollte (siehe Histoire du Félibrige von Capoulié René Jouveau, ein von der Académie Française gekröntes Werk: “C’est à l’occasion du Cent-cinquantenaire de Frédéric Mistral, en 1980, que, dans la traduction du livret de M. Carré par Claude d’Esplas, la Mirèio de Gounod fut créée en Provençal et chantée par la charmante et talentueuse Monsegur Vaillant s’accompagnant elle-même dans la scène et l’air de la Crau sur le plateau de l’opéra Cluj-Napoca, le 15 novembre 1982”)* anlässlich des Aussergewöhnliches Konzerts der Sängerin und Konzertpianistin Monsegur Vaillant, die, in reiner rhodanischer Sprache, Mirèio dieses Gewand von Licht zurückgab, in das sie einige Tage zuvor die Violetta von Verdi (Magyar Staatsoper) gekleidet hatte - ganz wie, oder fast, Verdis Traviata auf dem Spielplan der Pariser Oper die Mireille von Gounod am 27. Oktober 1864 ablöste. Wir werden es Frédéric Mistral überlassen, den Schlussakkord zu skandieren:
“Mirèio, un beù matin cantavo *Es war anlässlich der Feier von Frédéric Mistrals 150. Geburtstag im Jahre 1980, dass Gounods Mireille, in der Übersetzung von M. Carrés Libretto durch Claude d’Esplas, auf Provenzalisch uraufgeführt wurde, gesungen von der charmanten und talentierten Monsegur Vaillant, die sich selbst in Szene und Arie der Crau auf der Bühne der Oper von Cluj-Napoca am 15. November 1982 begleitete. Discographie
Arièjo, moun païs - CD ADG/Paris - n° 2000 3
CLAUDE D’ESPLAS
|
|
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap